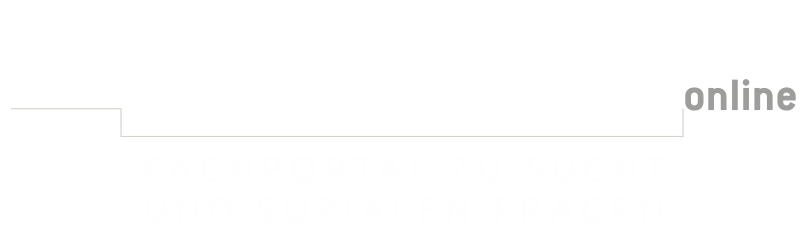Chancen eines Suchtverständnisses, das Vielfalt zulässt
Menschen konsumieren aus sehr verschiedenen Gründen psychoaktive Substanzen, ebenso unterscheiden sie sich darin, wie sie den Konsum erleben. Das trifft auch für Menschen zu, die ihren eigenen Konsum als „süchtig“ beschreiben würden. Demgegenüber beruhen klinische Diagnosesysteme auf der Reduktion von Diversität und Komplexität, indem sie eine bestimmte Anzahl bestimmter Merkmale zu dem Ergebnis „Abhängigkeit“ oder „substance use disorder“ zusammenfassen. Um die Diversität der subjektiven Motive und Funktionen bei „süchtigem“ Konsum zu erfassen, hat Prof. Dr. Rebekka Streck mit ihrer Projektgruppe zehn Personen in problemzentrierten Interviews befragt. Im Artikel stellt sie die Analyse der Aussagen vor und plädiert für ein Suchtverständnis, das Vielfalt zulässt. » zum Artikel