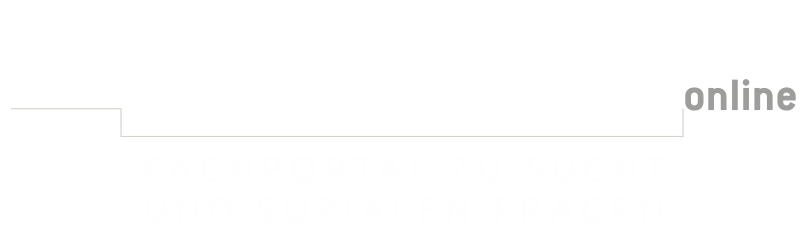Ideen für die Suchtprävention und Suchthilfe von morgen – ein Erfahrungsbericht
Keine Angst vor KI – im Januar 2024 trafen sich 30 Expert:innen beim KISucht Hackathon in Berlin und erläuterten Einsatzmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz in der Suchthilfe und Suchtprävention. In einem kreativen Ideenwettbewerb wurden verschiedene Anwendungen von KI erarbeitet, die die Missionen dieser Arbeitsfelder unterstützen sollen. Wolfgang Rosengarten hat an der Veranstaltung teilgenommen und berichtet über Ausgangssituation und Ergebnisse. Vor allem wurde klar: Die Suchthilfe sollte in einem großen Netzwerk die Weiterentwicklung und den Einsatz digitaler Werkzeuge in ihrem Aufgabengebiet vorantreiben. » zum Artikel